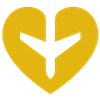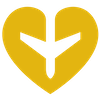Ich erinnere mich noch gut an meine Überfahrt mit der Buquebus-Fähre von Buenos Aires nach Colonia del Sacramento. An Deck ein weiter Blick über den Río de la Plata – und in der Luft: dichter, beißender Dieselgestank. Ein bisschen Fernweh, aber auch ein bisschen Fährweh. Umso bemerkenswerter, dass genau auf dieser Strecke jetzt ein neues Kapitel geschrieben wird. Denn der Fährbetreiber Buquebus wird künftig mit der größten jemals gebauten Elektrofähre operieren – konstruiert vom australischen Schiffbauer Incat.
Das vollelektrische Schiff trägt den wenig poetischen Namen Hull 096, misst 130 Meter und kann bis zu 2.100 Passagiere sowie 225 Fahrzeuge transportieren. Mit seinen 275 Tonnen Batterien – ja, du hast richtig gelesen – ist es das größte Elektrofahrzeug, das je gebaut wurde. Und obwohl die Route zwischen Argentinien und Uruguay nur knapp 200 Kilometer umfasst, ist das Projekt alles andere als klein gedacht: Es ist ein Statement.
Ein Gigant für kurze Strecken – und ein Signal für die Zukunft
Der Schiffsbauer Robert Clifford erklärte gegenüber "Business Insider", dass er die Zukunft klar in kurzen, aber frequentierten Verbindungen wie dem Ärmelkanal, der Ostsee oder eben dem Río de la Plata sieht. Denn auch wenn die Nachfrage nach sauberem Seetransport steigt – die Technologie hat ihre Grenzen.

Elektrofähre: Die Batterie als Bottleneck
Der limitierende Faktor heißt Energiedichte. Batterien sind schwer und brauchen Platz – vor allem im Vergleich zu fossilen Brennstoffen. Die Rechnung ist einfach: Bei Strecken unter 80 Kilometern machen Elektrofähren Sinn, bei über 300 Kilometern wird es schon eng – nicht nur rechnerisch, sondern auch wirtschaftlich. Noch.
Deshalb setzt Incat gezielt auf Routen, die sowohl logistisch als auch ökologisch sinnvoll sind. Und auf Abnehmer wie Buquebus, die den Mut haben, umzudenken. Ursprünglich war die Hull 096 als LNG-Schiff geplant – doch Incat überzeugte den Betreiber, auf vollelektrisch umzuschwenken. Dass das gelang, zeigt: Es gibt einen echten Wunsch nach Veränderung, auch auf Seiten der Betreiber.
Eine Elektrofähre verändert das Spiel – aber reicht das?
So sehr der Schiffbauer auch von seinem Projekt überzeugt ist – und das mit gutem Grund – bleibt eine Herausforderung: Skalierung. Wer bislang ein bis zwei Schiffe pro Jahr baut, muss sich ganz anders aufstellen, wenn plötzlich vier, fünf oder mehr Großaufträge gleichzeitig umgesetzt werden sollen. Von 500 auf 3.000 Mitarbeitende aufzustocken, ist ein Kraftakt – ganz zu schweigen von den logistischen und infrastrukturellen Hürden.
Und doch: Clifford vergleicht seine Situation mit der von William Boeing. Der startete auch als Bootsbauer – und wurde dann zu einem der größten Flugzeughersteller der Welt. Warum also nicht auch eine Werft in Hobart, die den globalen Schiffbau elektrifiziert?

Fazit: Mehr als Symbolpolitik – ein echter Aufbruch
Die Elektrofähre ist mehr als eine technische Spielerei für Umweltfreund:innen. Sie ist ein reales Beispiel dafür, dass nachhaltige Technologie auch in der Logistik ankommt – und dabei sogar konkurrenzfähig wird. Klar: Für den Transatlantiktransport auf dem Wasser taugt sie nicht. Aber für genau die Strecken, auf denen täglich Tausende Menschen pendeln – und auf denen jeder Liter Diesel, der nicht verbrannt wird, zählt.
Vielleicht bedeutet „nachhaltig reisen“ bald nicht nur den Zug statt Flieger – sondern auch: saubere Überfahrt statt qualmender Fähre. Ich jedenfalls hätte meine damalige Buquebus-Überfahrt mit einem elektrisch betriebenen Schiff deutlich lieber in Erinnerung. Ganz ohne Rußwolke – dafür mit Aussicht.
Das könnte dich auch interessieren: